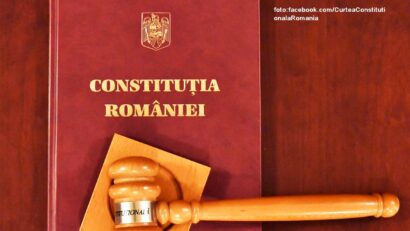Zum Internationalen Tag der Roma: Über die Gefahr des Exzeptionalismus und die Bedeutung von Lernkontexten
Seit 1971 ist der 8. April als Internationaler Tag der Roma anerkannt. Obwohl die Roma die zweitgrößte ethnische Minderheit in Rumänien darstellen, sind sich Soziologen einig, dass die offiziellen Statistiken nicht annähernd die tatsächliche Zahl der Roma in der Bevölkerung widerspiegeln.

Iulia Hau, 23.04.2025, 20:28
Die meisten Medienberichte über Roma dokumentieren entweder das Ausmaß der anhaltenden Diskriminierung und Segregation oder porträtieren herausragende Persönlichkeiten aus der Roma-Gemeinde, deren Zahl stetig wächst. Währenddessen schaffen Ionela Pădure und ihr Ehemann in Vizurești, einem Dorf im Kreis Dâmbovița im Süden Rumäniens, Lern- und Entwicklungsräume für Kinder – Roma wie Nicht-Roma – direkt im eigenen Hof.
Ionela Pădure berichtet, dass bis vor Kurzem die meisten Studien über die Roma-Gemeinschaft von Personen außerhalb dieser Gemeinde durchgeführt wurden. Doch in den letzten Jahren treten immer mehr Roma selbst als Intellektuelle in Erscheinung – als Soziologen, Historiker oder Künstler – und nehmen aktiv an öffentlichen Diskursen teil. Sie bringen jene persönliche Perspektive ein, ohne die politische Veränderungen kaum praktische Wirkung im Alltag entfalten können.
Bevor Ionela Pădure dauerhaft nach Rumänien zurückkehrte und das Volksforschungs- und Dokumentationszentrum Vizurești gründete, absolvierte sie ein Studium im Ausland und unterrichtete Französisch an einem französischen College. Dennoch ist sie der Meinung, dass die Rede von „exzeptionellen Roma“ der Gemeinschaft ebenso schade wie diskriminierende Aussagen:
„Meiner Ansicht nach sollten wir, wenn wir über Roma sprechen, nicht in Begriffen wie ‚hat seine Herkunft überwunden‘ oder ‚ist eine Ausnahme in der Roma-Gemeinschaft‘ sprechen. Denn das schadet uns mehr, als es nützt. Diese Intellektuellen, von denen ich zuvor sprach, die aus vulnerablen Verhältnissen kamen, hatten ein bestimmtes Umfeld. Ich spreche oft von mir selbst als Ergebnis meiner Begegnungen mit Roma und Nicht-Roma. Ich, Ionela Pădure, hatte die Chance, an der Sorbonne zu studieren, weil ich auf Lehrkräfte traf, die mehr an mich glaubten als ich selbst. Schau dir (Nicolae) Furtună an, unseren Soziologen, Rowena Marin, Cristi (Pădure), die Romani-Lehrer mit Doktortiteln. Professor Negoi… All diese Menschen hatten Kontexte, in denen andere sie unterstützten. In Roma-Gemeinschaften kommen zur sozioökonomischen Benachteiligung oft rassistische Erfahrungen hinzu, die sich in konkreter Diskriminierung äußern. Und um das zu überwinden, ist zusätzliche Anstrengung nötig – die manche leisten, andere nicht. Aber wenn sie es nicht tun, wenn man es also nicht bis zur Sorbonne schafft, heißt das nicht, dass man weniger wertvoll, weniger gut, weniger fähig ist. Erfolg ist relativ. Und wenn wir über Roma-Gemeinschaften sprechen, sollten wir genau diese Vielfalt betonen. Es braucht keine außergewöhnlichen Leistungen, um gehört zu werden.“
Ionela Pădure betont, wie wichtig es sei, auch die Geschichten „gewöhnlicher“ Roma sichtbar zu machen – wie die ihrer Mutter, die ohne akademischen Werdegang sechs Kinder großzog, unter Bedingungen, die deutlich schwieriger waren als jene, in denen ihre Tochter heute lebt. Den diesjährigen 8. April verbrachte sie gemeinsam mit der feministischen Roma-Organisation E-Romnja und Frauen aus verschiedenen Roma-Gemeinschaften und Generationen aus dem ganzen Land – im Gespräch über ihre alltäglichen Lebensrealitäten. Diese Erfahrungen, so ist sie überzeugt, verdienen es, erzählt und gehört zu werden.
Nach ihrer Rückkehr aus Frankreich verbrachte Ionela zwei Jahre damit, die Kinder aus Vizurești zu beobachten, sie kennenzulernen und herauszufinden, was sie interessiert und was sie brauchen:
„Vizurești ist nicht mein Heimatdorf. Wir haben beschlossen, hierherzuziehen, nachdem wir aus Frankreich zurückkamen. Ich habe mir also die Kinder angeschaut… Was machen die Kinder in Vizurești? Und ich habe versucht herauszufinden, welche Fähigkeiten sie besitzen – Fähigkeiten, die von der Gesellschaft meist nicht anerkannt werden. Was können sie? Die Mädchen tanzen, die Jungen kämpfen. Okay. Dann müssen wir Soft Skills aufbauen. Gut – also knüpfen wir an das an, was sie schon können. So haben wir Tanzkurse und Boxkurse entwickelt, mit dem Ziel, ihre Beziehungen untereinander zu stärken, ihren Umgang mit Emotionen, ihre Identität usw. Seit fünf Jahren machen wir das nun. Und jeder Kurs, den wir anbieten, geht auf ein Bedürfnis der Kinder zurück. Ich habe – in diesen fünf Jahren – nie gesagt: ‚Ab morgen spielen wir Schach.‘ Nein. Was wollt ihr machen? Theater? Gut. Dann machen wir Theater. Warum? Weil sie so viel ausdrücken müssen. […] Wir bauen auf den Kompetenzen auf, die sie bereits besitzen. Denn wir erziehen Kinder nicht für Kontexte – wir schaffen Kontexte für Kinder. Genau das geschieht in Vizurești. Mein mittelfristiges und langfristiges Ziel ist es, neue Generationen von Facilitatorsund Trainer auszubilden. Vielleicht gehe ich in fünf Jahren wieder nach Paris – aber das Projekt soll dann weitergehen.“
Ionela Pădure legt großen Wert darauf, dass die Trainer in Vizurești ausschließlich Menschen sind, die die Kinder persönlich kennen. Sie erzählt auch, dass mittlerweile ältere Kinder mit mehr Erfahrung oft die Jüngeren anleiten und strukturieren. Für sie ist klar: Wenn ein Kind für eine Fähigkeit Anerkennung erfährt, stärkt das sein Selbstwertgefühl, verbessert die Beziehung zu sich selbst – und gibt ihm den Mut, seinen Horizont zu erweitern.