
„Attraktives Rumänien“ ist das erste nationale Programm zur Förderung des historischen Kulturtourismus, finanziert aus EU-Mitteln im Rahmen des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans (PNRR). Das Programm startete im Mai 2024 und wird vom Ministerium für Investitionen und Europäische Projekte koordiniert, der Institution, die für die Gewinnung europäischer Fördermittel für Rumänien zuständig ist. In einer Zeit, in der sich der globale Tourismus hin zu authentischen und nachhaltigen Erlebnissen entwickelt, unternimmt Rumänien damit einen wichtigen Schritt zur Modernisierung seines Kulturangebots.

Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert waren die rumänischen Fürstentümer ein Teil jener kulturellen Welt, die unter der Vorherrschaft des Osmanischen Reiches stand. An der Peripherie der islamischen Expansion gelegen, entwickelten sich die rumänischen Länder zu Unterstützern der christlichen Gemeinden im Nahen Osten – insbesondere durch die Herausgabe religiöser Bücher. So entstanden auf rumänischem Boden die ersten christlich-orthodoxen Texte in arabischer Sprache.

In der Geschichte der großen militärischen Auseinandersetzungen gibt es Schlachten, die sich durch besonders viele Opfer, durch einen Wendepunkt im Kriegsgeschehen, die völlige Verwüstung eines Ortes oder durch den Tod bedeutender Persönlichkeiten ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Während im Ersten Weltkrieg die Schlacht von Verdun zur „Mutter aller Schlachten“ erklärt wurde – als Sinnbild für Blutvergießen und Zermürbung –, war es im Zweiten Weltkrieg die Schlacht um Stalingrad, die zwischen August 1942 und Februar 1943 zu einem der entscheidendsten und verlustreichsten Kapitel wurde.

1965 nahm die Sozialistische Republik Rumänien offiziell diplomatische Beziehungen zu Australien und Neuseeland auf. Der internationale Kontext war günstig: Der Diktator Ceaușescu hatte die Beteiligung Rumäniens am Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei, um den sogenannten Prager Frühling um Alexander Dubček zu beenden, abgelehnt. Das hat ihm und dem vermeintlich aufmüpfigen Ostblockland Rumänien für einige Zeit internationales Ansehen gebracht. Der damalige Botschafter in den Ländern am Antipodenpunkt erinnerte sich in einem Zeitzeugeninterview von 1994 an die warmherzige Aufnahme, die er in Australien und Neuseeland erfuhr – auch durch die zumeist regimekritische rumänische Diaspora.
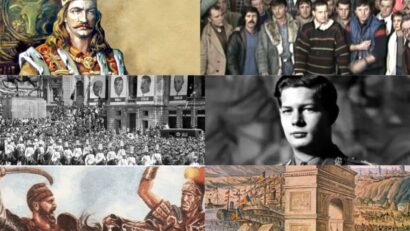
Am 20. Mai 1990 gingen Millionen Menschen in Rumänien an die Wahlurnen. Es waren die ersten freien Parlaments- und Präsidentschaftswahlen nach dem Sturz des kommunistischen Regimes am 22. Dezember 1989. Der Wahltag – ein Sonntag – ging in die Geschichte ein als die sogenannte „Sonntagswahl der Blinden“. Denn viele Wähler stimmten voller Hoffnung, aber auch voller Illusionen ab.

Einer der dunkelsten Tage in der modernen Geschichte Rumäniens ist der 6. März 1945. An diesem Tag wurde unter dem Druck des sowjetischen Gesandten Andrei Wyschinski eine Regierung eingesetzt, die von der Demokratischen Nationalen Front gebildet wurde, einer von der Kommunistischen Partei Rumäniens geführten Allianz.

Heute entdecken wir die wichtigsten touristischen Attraktionen im Kreis Mureș. Das Angebot umfasst besondere Landschaften mit jahrhundertealten Bäumen, Erlebnisparks, aber vor allem alte Herrenhäuser und Schlösser, von denen einige Veranstaltungen beherbergen. Um das kulturelle Angebot hervorzuheben, öffnen wir auch die Türen des Kreismuseums Mureș.

Die von 1967 bis Mitte der 1980er Jahre im Rumänischen Fernsehen ausgestrahlte Sendung „Reflector“ („Im Scheinwerferlicht“) deckte Missstände und Fehlleistungen in den staatlichen Institutionen oder der sozialistischen Konsumwirtschaft auf.

Für unser Geschichtsmagazin haben wir uns mit einer Historikerin unterhalten, die sich mit dem Thema Revolution von 1989 in einem Buch auseinandergesetzt hat.

Die rumänische Kultur ehrt im Jahr 2024 einen ihrer wichtigsten Vertreter, den Historiker und Literaturkritiker Eugen Lovinescu.

Präsident Klaus Johannis hat am Sonntag im deutschen Bundestag eine Rede anlässlich des Volkstrauertags zum Gedenken an die Opfer von Krieg und Diktatur gehalten.

In den kommunistischen Ostblockstaaten Mittel- und Osteuropas drehte sich die gesamte Presse um die Ideologie. Die kommunistischen Parteien gründeten zu diesem Zweck ihre eigenen Presseorgane, die das Wesen ihrer Ideologie zum Ausdruck brachten.

Vor kurzer Zeit hat im Nationalmuseum für rumänische Geschichte (MNIR) im Zentrum der Hauptstadt eine neue Ausstellung eröffnet, die neuere Schenkungen, erworbene Gegenstände und Funde sowie archäologische Entdeckungen zeigt.

Im Gespräch mit einem Archäozoologen erfahren wir interessante Details über die Nutzung dieser Huftiere entlang der Geschichte.

Die jüngere Geschichte wirft ihre Schatten immer noch. Seit über 30 Jahren kämpft der Sohn des Dissidenten Gheorghe Ursu darum, die Wahrheit über den Tod seines Vaters bekannt zu machen. Dieser war in einem Securitate-Gefängnis ermordet worden, nachdem er die Entscheidung Ceaușescus kritisiert hatte, die Sanierung der beim Erdbeben von 1977 beschädigten Gebäude zu stoppen. Der Fall des Ingenieurs Ursu und die Schwierigkeiten seines Sohnes Andrei, Gerechtigkeit zu erfahren, hat die Journalisten und Filmemacher Liviu Tofan und Șerban Georgescu angeregt, einen schockierenden Dokumentarfilm zu drehen.
