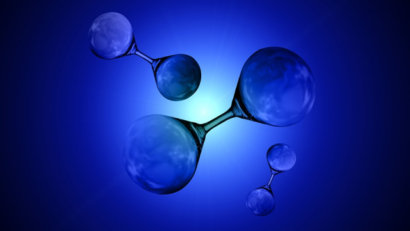Die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie
Die Kreislaufwirtschaft – ein Begriff, der immer öfter fällt. Sie ist die Alternative zum traditionellen Wirtschaftsmodell. Anders als beim klassischen Zyklus von „Produzieren, Nutzen, Entsorgen“ setzt die Kreislaufwirtschaft auf das Prinzip der Regeneration. Ziel ist es, Produkte, Komponenten und Materialien so lange wie möglich im Wirtschaftskreislauf zu halten. Dieses Modell soll nun auch in der Textilindustrie greifen, einem Sektor mit enormem Einfluss auf unsere Umwelt.

Daniel Onea und Adina Olaru, 13.10.2025, 16:09
Ab dem 1. Januar 2025 muss sich Rumänien, wie alle anderen EU-Mitgliedstaaten, an eine neue Richtlinie halten, die die massive Umweltverschmutzung durch die Textilindustrie eindämmen soll. Gemäß dieser Vorschrift wird die getrennte Sammlung von Textilabfällen verpflichtend. Ein notwendiger Schritt hin zur Kreislaufwirtschaft.
Vor zweieinhalb Jahren wurde der rumänische Verband für Textilwiederverwendung und -recycling, ARETEX, gegründet, um diese Prinzipien landesweit zu fördern. Zoltan Gyöndy, der Präsident des Verbandes, beziffert die Menge der in Rumänien jährlich weggeworfenen Textilabfälle auf rund 160.000 Tonnen. Der Großteil landet auf der Mülldeponie oder wird energetisch verwertet.
„Die Gesetzgebung, die seit dem 1. Januar in Kraft ist, verpflichtet alle Länder der Europäischen Union, getrennte Sammlungen zu organisieren. Das heißt, wir dürfen Textilien nicht in den Hausmüll werfen, denn dann ist selbstverständlich keine Wiederverwendung oder kein Recycling mehr möglich. Das entsprechende Gesetz legt ausdrücklich fest, dass Textilabfälle separat gesammelt werden müssen, es legt jedoch nicht ausdrücklich fest, dass es zwei Arten von Textilabfällen gibt: die wiederverwendbaren und die recycelbaren. Es spricht überhaupt nicht darüber, dass ein Großteil davon weder recycelbar noch wiederverwendbar ist und auch weiterhin einer thermischen Verwertung oder Verbrennung zugeführt wird.”
Das Potenzial für das Recycling und die Wiederverwendung von Textilien wird in Rumänien auf 30 Prozent geschätzt. Doch derzeit werden weniger als 10 Prozent tatsächlich wiederverwertet. Das größte Hindernis ist der Mangel an einer effizienten getrennten Sammlung, was auf eine fehlende angemessene Infrastruktur zurückzuführen ist.
„Bestimmte Kommunen haben Container gekauft, sammeln die Textilien separat, und danach passiert nichts mehr damit, weil die nächsten Schritte fehlen. Das heißt, die Entsorgungsunternehmen tun dies nicht! Sie sind weder Spezialisten für die Wiederverwendung von Textilien, noch für das Recycling von Textilien und so weiter. Es muss also eine Lösung gefunden werden, durch die die bestehenden Akteure in diesen Kreislauf eintreten können, aber eben nicht als Pilotprojekt, pro bono. Einige haben das in Bukarest gemacht, andere in Cluj, andere in Satu Mare, andere in Oradea, so eine Sammlung für eine bestimmte Stadt. Auf mittlere Sicht ist das nicht nachhaltig. Der Wert, der aus dem Bereich der wiederverwendeten Kleidung erzielt wird, muss alle Kosten decken – die der Sammlung, der Sortierung, der Behandlung, der Reinigung, des Recyclings. Heute verursacht das Recycling Kosten, es bringt keine Einnahmen.”
Zusammenfassend lässt sich sagen: Der 1. Januar 2025 markiert eine entscheidende Phase für Rumänien im Umgang mit Textilabfällen. Auch wenn die Umsetzung des neuen Gesetzes eine Herausforderung sein wird, sind die Bemühungen um den Aufbau einer nationalen Recycling-Infrastruktur unerlässlich, um die Umwelt zu schützen und uns an die europäischen Nachhaltigkeitsziele anzupassen.